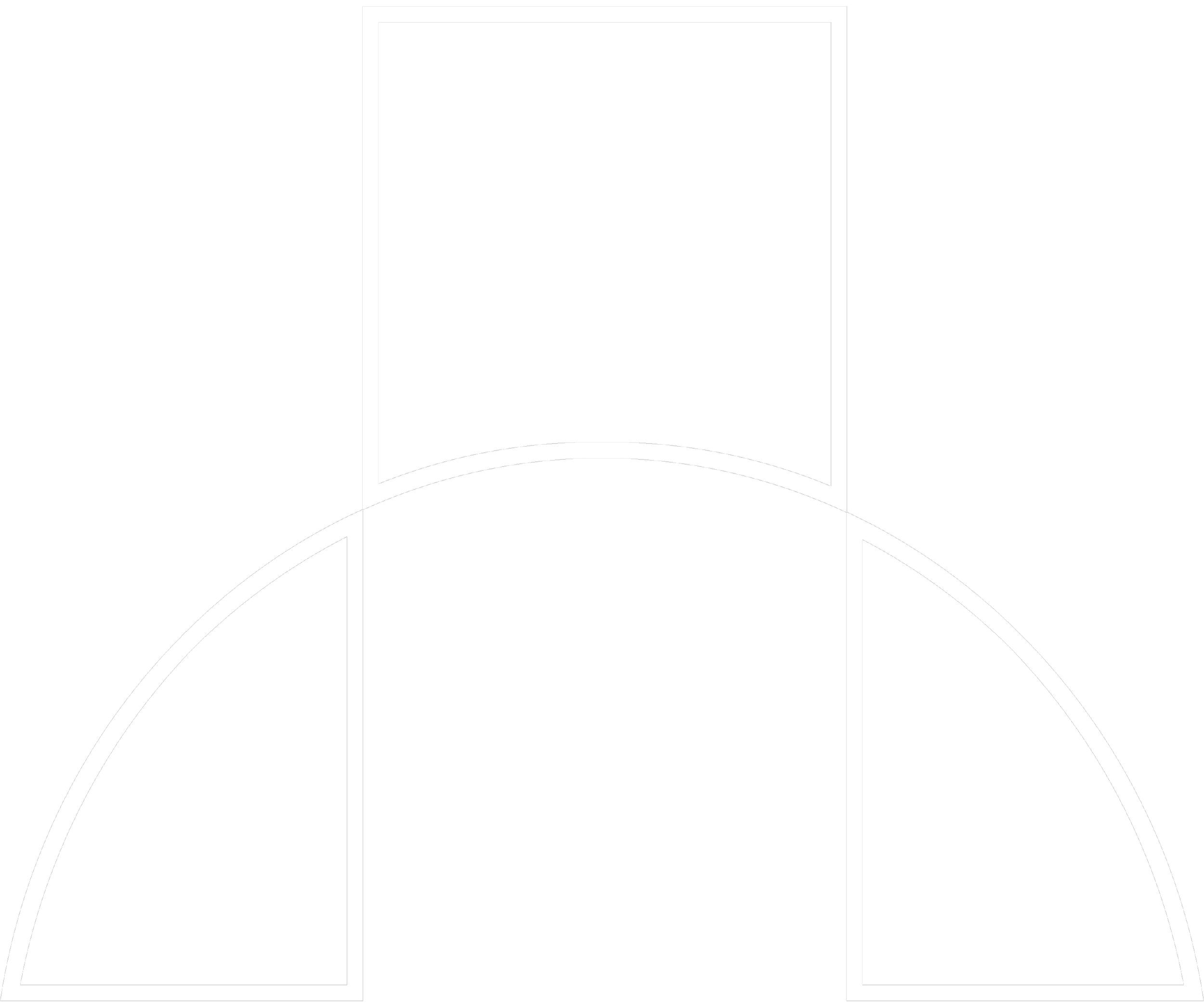Innovation – Öffnen der Black Box
Wir freuen uns über einen Beitrag von Heinz-Klaus Stahl zum Magazin von Systemix Reloaded! Es greift darin auch noch einmal Aspekte des Interviews von Joachim Funke über ein evolutionäres Verständnis kreativer Prozesse auf. Wir wünschen viel Vergügen beim Lesen! Der Innovationsprozess in Organisationen wird meist als schwarzer Kasten konzipiert. Was innerhalb des Kastens vor sich geht, darüber gibt es zwei Denkschulen. Die eine sieht den Prozess als geordneten Lernvorgang. Eine Neuerung ist dann das Endergebnis einer Unzahl kleiner Schritte, die durch dämpfende oder verstärkende Rückkoppelungen auf ein vorgegebenes Ziel hin angepasst werden. Es ist das Modell von "Versuch und Irrtum". Innovation ist danach grundsätzlich "machbar". Eine Kultur der Fehlertoleranz und hohe Kommunikationsdichte halten den Innovationsprozess in Gang.
Die andere Denkschule könnte man evolutionär nennen. Innovation ist hier ein Zufallsprodukt "blinder" Variationen, die hauptsächlich durch äußere Ereignisse ausgelöst werden. Das einzige, was eine Organisation tun kann, um das Entstehen von Neuerungen zu fördern, ist die Öffnung nach außen: Ein geringes Komplexitätsgefälle zu den relevanten Umwelten hilft, Zufallsereignisse "einzufangen" und Neuerungsprozesse auszulösen.
Versuchen wir doch mal, den Deckel des schwarzen Kastens zu öffnen und sehen uns als Beispiele zwei erfolgreichen Innovationsprozesse von biomedizinischen Entwicklungen (ein Cochlear-Implantat und eine Methode zur Entfernung von Immmunoglobulinen aus dem Blut) an. Diese Prozesse erstreckten sich über einen Zeitraum von immerhin 152 bzw. 96 Monaten. Kann man nun in den vielen Deutungen, Schritten und Rückkoppelungen dieser Prozesse ein Muster entdecken? Die Innovationsprozesse schienen in drei Phasen abzulaufen: eine lange, etwa die Hälfte der gesamten Dauer umfassende, chaotische Explorationsphase; eine kürzere geordnete Markteintrittsphase; und eine Übergangsphase dazwischen.
Scheuklappen für die Phantasie In der chaotischen Phase war keine Spur von "Lernen" im klassischen Sinn zu finden. Schon die Startbedingungen waren vage, da genaue Projektziele und Bewertungskriterien fehlten. Es gab immer wieder Parallelaktivitäten, die verschiedensten Leute klinkten sich in die Projekte ein und aus, Ideen und Aktionspfade wurden laufend neu interpretiert und verworfen. Vorrang hatte das, was den jeweiligen Projektverantwortlichen gerade besonders in Atem hielt. Charakteristisch für diese chaotische Phase war die Entkoppelung von Handlungen und ihren Ergebnissen. Die Projekt¬gruppen schufen sich so ein reichhaltiges Repertoire möglicher Wirklichkeitskonstruktionen. Das war zwar kreativ, aber überhaupt nicht effizient.
Und hier beginnt das Problem der Unternehmensführung. Es ist schon beanspruchend genug, Projekte dieses Umfangs mit weitgehender Zielunklarheit starten zu lassen. Noch strapaziöser ist es, die Geduld aufzubringen, die chaotische Phase über Jahre durchzuhalten. Der Übergang in die Schlussphase geordneten Lernens wird dem Projekt zwar ohnehin von außen auferlegt, denkt man etwa an gesetzliche Testbestimmungen. Aber die Versuchung für das Management ist dennoch groß, frühzeitig mit all der Ambiguität Schluss zu machen, und sei es nur aus Sorge um die Investitionen. Aktionspläne müssen also her, um die Handlungen wieder an konkrete Ergebnisse und Zeitvorgaben zu koppeln. Zugleich legen sie natürlich der Phantasie straffe Zügel an (im britischen Englisch nutzt man oft die Metapher „blinkered“, abgeleitet von den Scheuklappen, die man einem Pferd anlegt, damit es nur vorwärts, aber nicht links oder rechts gucken kann)
Die Kunst der Unternehmensführung besteht darin, im richtigen Zeitpunkt von lockerer auf straffe Führung der Prozessphasen umzuschalten. Geschieht dies zu früh, wird zwar "Leadership" (nichts anderes als „Führungsstärke“, mit der den Geführten Eindeutigkeit verordnet wird) bewiesen, aber doch nur Scheineffizienz erreicht und die Beteiligten auf einen unter Umständen völlig falschen Kurs eingeschworen. Wird zu spät geschaltet, entwickeln die Projekte ein Eigenleben oder sie verlieren sich in schwer durchschaubaren Verzweigungen. In der erfolgreichen Bewältigung dieses nicht unbekannten Dilemmas liegt jedenfalls ein rarer, weil schwer imitierbarer Wettbewerbsvorteil für die innovative Organisation.
Am glücklichsten dürften jene Innovationsbewussten sein, die auf Grund der Größe, Organisation oder Art ihres Unternehmens nicht ausschließlich auf den Output riskanter und schwer handhabbarer Projektgruppen angewiesen sind, sondern besonders auf die Kreativität von Einzelkämpfern zählen können. Sogenannte disruptive Innovationen haben ihren Ursprung, nicht wie oft behauptet, in kreativen Teams, sondern in dem Beharrungsvermögen von Tüftlern. Diese profitieren davon, dass das Management, bewusst oder aus Versehen Nichtrationalität innerhalb der Organisation zuläßt. Wer sich darin üben will, vom vermeintlich „objektiven“, rationalen Denken abzulassen, folgt am besten den meditativen Beispielen eines BRAHMS, PUCCINIs oder WAGNERs; oder den Erfahrungen von AUGUST KEKULÉ, dem sich im Halbschlaf die Form des Benzolrings erschloss. Hier können sich die langen Thetawellen im Gehirn entfalten, während uns im normalen Wachzustand die Alpha- und Betawellen „bloß“ das ganz gewöhnliche Überleben sichern.
So wenig neu das Plädoyer für Nichtrationlität auch sein mag, es kommt zur richtigen Zeit. Die aktuelle Maxime des "schneller, besser, billiger" setzt in den Unternehmen zwar stillschweigend ein hohes Maß an kreativer Intelligenz voraus, entzieht ihr aber zugleich die Grundlage ihrer Entfaltung. Ein unerbittlicher Zeittakt und die bevorzugte Übersetzung von subjektiver Wirklichkeit in "objektive" Zahlen lassen ein Sich-Zurückziehen in die Nichtrationalität gar nicht zu. Geschweige denn in den Halbschlaf (Wiewohl der, wenn auch nur zögerliche Trend zum kreativen Nickerchen im Betrieb Hoffnung aufkeimen lässt).
Heinz-Klaus Stahl